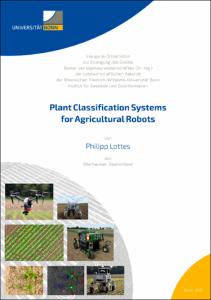E-Dissertationen: Search
Now showing items 1-10 of 87
The roles of nutrition-sensitive interventions and market access in enhancing household food security and resilience in Sierra Leone
(2021-05-17)
Using Sierra Leone – a post-conflict country in West Africa – as a case study, this dissertation addresses pressing issues on how to make smallholder agriculture more nutrition-sensitive, mitigate the adverse effects of ...
Options for sustainable agricultural intensification in maize mixed farming systems: explorative ex-ante assessment using multi-agent system simulation
(2021-02-17)
Nutrient depletion is a major limiting factor to agricultural sustainability in cereal dominated smallholder farming systems in Africa where over 80% of arable land is unsuitable to support primary productivity. This ...
Adaptation strategies to climate change in inland valleys in Dano, Burkina Faso
(2021-06-16)
The agriculture in Sub Saharan Africa at many locations is under-performing and lags behind the other continents in terms of yields as well as productivity. The recent progression in the produced quantities is mainly due ...
Uranium accumulation in agricultural soils as derived from long-term phosphorus fertilizer applications
(2021-03-04)
It is well known that uranium (U) in mineral phosphorus (P) fertilizers may accumulate in agricultural soils; yet, this U accumulation occurs at different rates, likely depending on the type of fertilizer used. To substantiate ...
Algebraic, logical and stochastic reasoning for the automatic prediction of 3d building structures
(2021-01-26)
3D building models are nowadays an important prerequisite for many applications such as rescue management or navigation tasks. However, most approaches for the automatic reconstruction of buildings rely on high-resolution ...
Plant Classification Systems for Agricultural Robots
(2021-03-16)
Due to a continually growing world population, the demand for food and energy increases continuously. As a central source of food, feed, and energy, crop production is therefore called upon to produce higher yields. To ...
Exact Optimization Algorithms for the Aggregation of Spatial Data
(2020-12-16)
The aggregation of spatial data is a recurring problem in geoinformation science. Aggregating data means subsuming multiple pieces of information into a less complex representation. It is pursued for various reasons, like ...
Concepts for the assessment and improvement of animal welfare during stressful and painful management procedures with a focus on piglet castration
(2021-09-06)
The welfare of farm animals is a topic of rising importance to consumers and livestock owners. Many procedures that are routinely performed in young livestock, for example the surgical castration of piglets, are considered ...
Interlinkage between food prices and agricultural wages and implications for farm mechanization in Bangladesh
(2021-12-01)
In recent decades, Bangladesh’s economy has undergone a remarkable structural transformation. Agricultural wages are becoming high while staple food prices are becoming volatile. In the meantime, agriculture has experienced ...
Intestinal integrity characteristics of growing pigs in response to oregano essential oil supplementation
(2021-09-06)
The production of protein of animal origin is of great importance worldwide. In Germany, pig production is of considerable importance to meet this need. To ensure successful animal production, an intact intestinal tract ...