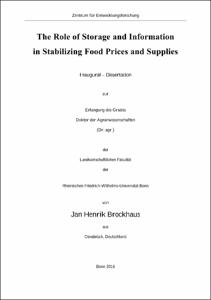E-Dissertationen: Suche
Anzeige der Dokumente 1-10 von 12
Einfluss unterschiedlicher Ozon-Immissionsmuster auf das Pathosystem Weizen-Mycosphaerella graminicola
(2002)
Weizenpflanzen wurden in Klimakammern bei unterschiedlichen Ozon-Immissionsmustern exponiert und der Einfluss der Schadgasbelastung auf das Pathosystem Weizen- Mycosphaerella graminicola untersucht. Die Wirkung eines ...
Zur Bedeutung von Umweltbedingungen und pflanzenbaulichen Maßnahmen auf den Fusarium-Befall und die Mykotoxinbelastung von Weizen
(2004)
In mehrjährigen Untersuchungen wurde der Einfluss pflanzenbaulicher Maßnahmen des Organischen und integrierten Anbaus auf die Pflanzengesundheit von Weizen im Rheinland erfasst. Hierbei wurden die Auswirkungen des Standorts, ...
Empfehlungen von Winterweizensorten im Organischen Landbau über die Kleberproteinfraktionen und deren Einfluß auf die Backqualität
(2001)
In dieser Arbeit wird die systematische Untersuchung der Kleberproteine von Winterweizen aus Organischem Landbau der Ernten 1997 bis 1999 beschrieben.
Ziel ist es, anhand der qualitätsbestimmenden Proteinfraktionen ...
Ziel ist es, anhand der qualitätsbestimmenden Proteinfraktionen ...
Experimentelle Untersuchungen zur Feuchtgetreidekonservierung im Folienschlauch
(2008)
Das Verfahren der Einlagerung von gequetschtem Futtergetreide in Folienschläuchen mit einer Schlauchpresse mit integrierter Walzenquetsche (Crimper-Bagger) stellt eine technische Alternative zu konventionellen Techniken ...
Comparison of DRIS and critical level approach for evaluating nutrition status of wheat in District Hyderabad, Pakistan
(2012-03-07)
Intensive cropping systems, improper use of fertilizers or no fertilizer application, and unreliable and poor quality of irrigation water have led to declining soil fertility in the district of Hyderabad, Pakistan. To date, ...
Auftreten der partiellen Taubährigkeit in Weizenbeständen – räumliche Verteilung der Fusarium-Arten und assoziierter Mykotoxine
(2010-01-07)
In den Jahren 2006 und 2007 wurde die räumliche Verteilung von Fusarium spp. und assoziierter Mykotoxine in natürlich infizierten Weizenfeldern auf der Regionalebene und auf der Bestandesebene untersucht. Auf der Regionalebene ......
Occurrence of Fusarium head blight in wheat fields - spatial distribution of Fusarium species and associated mycotoxins
Investigations into the spatial distribution of Fusarium spp. and associated ......
Occurrence of Fusarium head blight in wheat fields - spatial distribution of Fusarium species and associated mycotoxins
Investigations into the spatial distribution of Fusarium spp. and associated ......
Potential of fluorescence techniques with special reference to fluorescence lifetime determination for sensing and differentiating biotic and abiotic stresses in Triticum aestivum L.
(2011-07-22)
The key objective of the present thesis was to early assess physiological modifications of wheat plants due to biotic and abiotic stresses by means of non-destructive fluorescence measurement techniques.
Experiments ......
Potenzial von Fluoreszenztechniken unter besonderer Berücksichtigung der Fluoreszenzlebenszeit-Bestimmung zur Erfassung und Differenzierung biotischen und abiotischen Stresses in Triticum aestivum L.
Experiments ......
Potenzial von Fluoreszenztechniken unter besonderer Berücksichtigung der Fluoreszenzlebenszeit-Bestimmung zur Erfassung und Differenzierung biotischen und abiotischen Stresses in Triticum aestivum L.
Erfassung befallsrelevanter Klimafaktoren in Weizenbeständen mit Hilfe digitaler Infrarot-Thermografie
(2006)
Die digitale Infrarot-Thermografie ermöglicht eine abbildende, flächige Messung der Ober-flächentemperatur von Pflanzen (-beständen), deren Verteilung in einem Geoinformations-system untersucht werden kann.
Die ...
Die ...
The Role of Storage and Information in Stabilizing Food Prices and Supplies
(2016-08-03)
High and volatile food prices can push people into poverty, impact production and consumption, discourage investments, and lead to social unrest. Thus, due to occasional global food shortages as in 2007/08 and frequent ...
Genetic and physiological characterization of traits related to salinity tolerance in an advanced backcross population of wheat
(2018-03-22)
In large areas of the world wheat production is highly affected by soil salinity. Increasing the genetic variability of currently used wheat varieties is an efficient approach to overcome production losses and prevent food ......
Genetische und physiologische Charakterisierung von Merkmalen im Bezug auf Salztoleranz in einer Rückkreuzungspopulation von Weizen
Die Versalzung der Böden beeinträchtigt in weiten Teilen der Welt ......
Genetische und physiologische Charakterisierung von Merkmalen im Bezug auf Salztoleranz in einer Rückkreuzungspopulation von Weizen
Die Versalzung der Böden beeinträchtigt in weiten Teilen der Welt ......